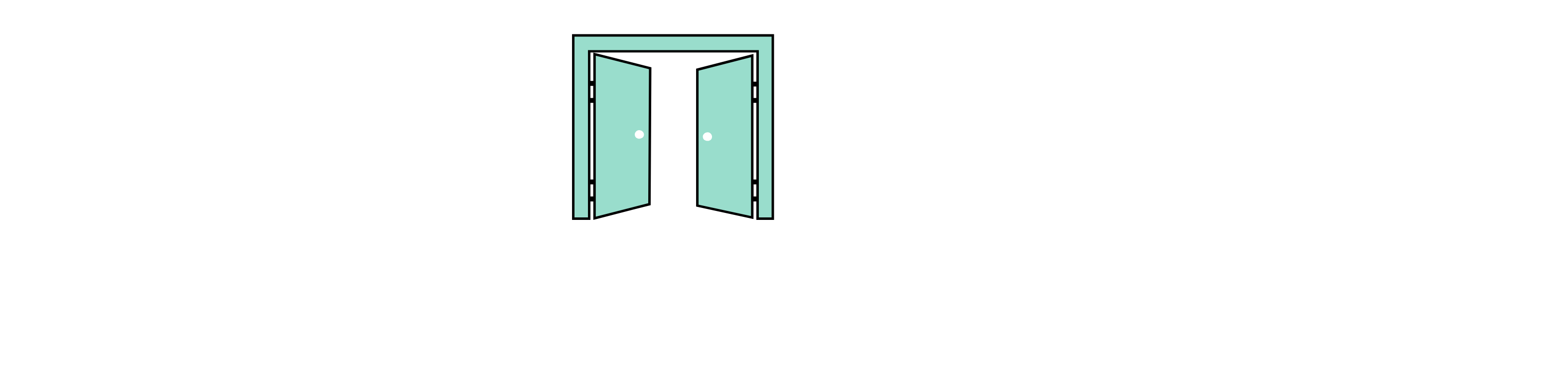Als Wissenschaftlerin frage ich mich immer wieder: Was weiß eigentlich die Wissenschaft darüber, welche Auswirkungen Digitale Barrierefreiheit hat? Dass sie praktischen Nutzen hat, ist logisch. Aber lässt sich der auch quantifizieren? Wie sieht die Studienlage dazu aus, was überhaupt barrierefrei ist? Und welche konkreten Tipps können wir für die Praxis aus den Studien ableiten? Diesen und weiteren Fragen widme ich mich in dieser Reihe.
Vertrauen in Digital Health: Warum Barrierefreiheit ein Schlüssel ist
Digitale Gesundheitsangebote sind längst Teil des Alltags – von der Praxis-Website bis zur Terminbuchung per App. Ob diese Angebote wirklich genutzt werden, hängt aber entscheidend davon ab, ob Patient*innen – und Ärzt*innen – ihnen vertrauen.
Eine Scoping-Review von Adjekum, Blasimme und Vayena (2018) hat 278 Studien ausgewertet und untersucht, wie Vertrauen in digitale Gesundheit entsteht – und was es zerstören kann. Die Ergebnisse sind hochrelevant für alle, die digitale Angebote einsetzen.
Was bedeutet „Digital Health“ eigentlich?
Der Begriff Digital Health umfasst den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien, um die Gesundheit und das Wohlbefinden einzelner Personen oder ganzer Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Dazu zählen mobile Gesundheits-Apps, Wearables, Telemedizin, elektronische Gesundheitsakten (EHRs) oder auch KI-gestützte Systeme.
Eine einheitliche Definition gibt es bislang nicht – verschiedene Begriffe wie „eHealth“, „mHealth“ oder „digitale Medizin“ werden oft synonym verwendet. Klar ist aber: Digitale Gesundheit verändert Diagnostik, Behandlung und Patient*innen-Kommunikation tiefgreifend.
Vertrauen – die unsichtbare Grundlage
Im Gesundheitswesen ist Vertrauen ein Schlüssel. Es bestimmt, ob Patient*innen Zugang suchen, Behandlungen annehmen und digitale Anwendungen überhaupt nutzen.
Doch Vertrauen ist schwer greifbar. Es kann durch konkrete Faktoren entstehen:
- Zuverlässigkeit: funktioniert die Technik, ist sie stabil?
- Kompetenz: liefert sie verlässliche Ergebnisse?
- Integrität: geht der Anbieter verantwortungsvoll mit Daten um?
Diese Erwartungen übertragen sich immer stärker auch auf digitale Systeme.
Drei Dimensionen des Vertrauens
Die Studie zeigt, dass Vertrauen von drei Ebenen geprägt wird: der persönlichen, der technologischen und der institutionellen.
Persönliche Faktoren
Vertrauen wächst, wenn Nutzer*innen den Eindruck haben, dass eine Technologie ihr Leben wirklich erleichtert – statt sie zu belasten.
Förderlich sind zum Beispiel:
- Gute Benutzerfreundlichkeit: Eine Praxis-Website, die mit wenigen Klicks einen Termin vergibt, wirkt vertrauenswürdiger als ein Formular mit zehn Pflichtfeldern.
- Empfehlungen durch Vertrauenspersonen: Wenn Hausärzt*innen oder Bekannte eine App oder Website empfehlen, steigt die Bereitschaft, sie zu nutzen.
- Gerechter Zugang: Wenn eine Terminbuchung sowohl online als auch telefonisch möglich ist, fühlen sich auch Menschen ohne Smartphone einbezogen.
Barrieren sind dagegen:
- Sorge vor Datenmissbrauch: Patient*innen misstrauen Tools, wenn unklar ist, wie mit Gesundheitsdaten umgegangen wird.
- Hohe Kosten: Eine App, die nur mit teurem Abo funktioniert, schreckt ab.
- Eingeschränkter Zugang: Wenn digitale Angebote nur in winziger Schrift, auf Englisch oder nur auf großen Screens, nicht aber auf dem Smartphone laufen, werden viele ausgeschlossen.
Technologische Faktoren
Digitale Anwendungen müssen zuverlässig funktionieren – sonst verlieren Nutzer*innen sofort das Vertrauen.
Förderlich sind zum Beispiel:
- Robuste Systeme: Eine Online-Terminbuchung, die auch unter starkem Zoom oder bei hoher Auslastung nicht abstürzt, wirkt verlässlich.
- Datenschutz und Sicherheit: Ein Patient, der klar erkennen kann, dass seine Daten verschlüsselt übertragen und nicht weitergegeben werden, fühlt sich sicherer.
- Anpassbares Design: Wer Schriftgröße oder Kontraste selbst einstellen kann Inhalte vergrößern kann, nutzt die Anwendung eher.
- Interoperabilität: Wenn das Terminbuchungstool direkt mit dem Praxisverwaltungssystem verbunden ist, spart das Zeit – für Patient*innen und Praxis.
Barrieren sind dagegen:
- Intransparente Funktionen: Wenn unklar ist, welche Daten im Hintergrund gesammelt werden, sinkt das Vertrauen.
- Defekte oder schlecht getestete Technik: Ein Kontaktformular, das aus unerfindlichen Gründen nicht abgesendet werden kann, ohne dass es näherer Erklärungen gibt, frustriert und schreckt ab.
Institutionelle Faktoren
Nicht nur die Technik selbst, auch das Umfeld entscheidet über Vertrauen. Strukturen, Kommunikation und der Ruf einer Organisation sind entscheidend.
Förderlich sind zum Beispiel:
- Transparente Kommunikation: Wenn eine Praxis klar erklärt, wie ihr Online-Terminservice funktioniert, fühlen sich Patient*innen sicher.
- Reputation: Ein vertrauenswürdiger Ruf entsteht nicht nur durch medizinische Qualität, sondern auch durch digitale Angebote, die Patient*innen ernst nehmen. Eine barrierefreie Website zeigt: Hier sind alle willkommen – das stärkt die Beziehung und das Vertrauen.
- Nutzer*innen einbeziehen: Wenn Patient*innen Rückmeldungen geben können („Feedback“-Button, kurze Umfragen, Kontaktformular zur Melden von Barrieren) und Änderungen sichtbar umgesetzt werden, steigt die Akzeptanz.
- Arbeitsentlastung: Systeme, die wirklich Zeit sparen – z. B. eine gut funktionierende Online-Rezeption, die an die Praxissysteme angebunden ist – werden von Ärzt*innen eher akzeptiert.
Barrieren sind dagegen:
- Zeitaufwändige Systeme: Wenn Dokumentation oder Anmeldung länger dauert als vorher, wird die Technik schnell gemieden.
- Unklare Standards: Wenn jede Praxis andere Tools nutzt, müssen Patient*innen ständig neu lernen – das sorgt für Frust.
- Unzureichende Schulungen: Praxispersonal, das mit der Technik überfordert ist, kann Patient*innen nicht gut unterstützen.
Und was hat das mit Barrierefreiheit zu tun?
Die in der Studie beschriebenen Vertrauenselemente überschneiden sich in vielerlei Hinsicht mit den Prinzipien digitaler Barrierefreiheit. Vertrauen wächst, wenn digitale Angebote verständlich, stabil und inklusiv sind – genau das sind auch die Ziele barrierefreier Gestaltung.
Auf der persönlichen Ebene fördert Barrierefreiheit das Gefühl, ein Angebot wirklich nutzen zu können. Ein Beispiel: Wer motorische Einschränkungen hat, kann eine Website nur dann bedienen, wenn sie auch per Tastatur steuerbar ist. Eine Praxis, die darauf achtet, signalisiert: „Wir wollen, dass Sie dabei sind.“ Das stärkt nicht nur die Nutzbarkeit, sondern auch das Vertrauen.
Auch die technologischen Faktoren sind eng verbunden: Barrierefreie Systeme sind in der Regel robuster und kompatibel mit Hilfsmitteln wie Screenreadern oder Vergrößerungssoftware. Wenn ein Kontaktformular auch bei 200 % Zoom noch funktioniert, entsteht der Eindruck von Stabilität – und genau das erhöht die Bereitschaft, das digitale Angebot zu verwenden.
Auf institutioneller Ebene schließlich geht es um Reputation und Verantwortungsbewusstsein. Eine barrierefreie Website zeigt, dass eine Praxis ihre Patient*innen in ihrer Vielfalt ernst nimmt. Wer merkt, dass Rückmeldungen zu Barrieren gehört und umgesetzt werden, erlebt die Praxis als transparent, respektvoll und kompetent – und vertraut ihr auch im digitalen Raum.
Barrierefreiheit ist also kein „Add-on“. Sie wirkt wie ein Querschnittsfaktor, der in allen drei Dimensionen Vertrauen fördert – und damit die Grundlage für erfolgreiche digitale Gesundheitsangebote legt.
Fazit
Vertrauen ist die Grundlage dafür, dass digitale Gesundheitsangebote genutzt werden. Die Forschung zeigt: Es entsteht, wenn Systeme verlässlich, verständlich und fair zugänglich sind. Genau das sind auch die Prinzipien digitaler Barrierefreiheit.
Wer Barrieren abbaut, stärkt nicht nur die Nutzbarkeit für alle Patient*innen – sondern auch das Vertrauen in die eigene Praxis und ihre digitalen Angebote.
Adjekum, A., Blasimme, A., & Vayena, E. (2018). Elements of trust in digital health systems: scoping review. Journal of medical Internet research, 20(12), e11254. doi: https://doi.org/10.2196/11254